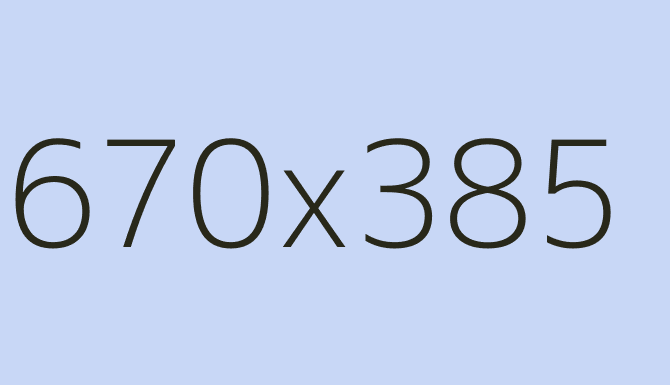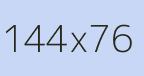Text von Tanja Breukelchen für change – das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Ausgabe 4/2015 (gekürzte Fassung).

Axel Martens
Im Einklang mit dem Leben
Musik umgibt uns. Musik berührt uns. Wer sich auf sie einlässt und auf frühe und positive Weise an sie herangeführt wird, findet in ihr einen Begleiter fürs Leben. Doch auch eine späte Liebe zur Musik ist möglich. Ein Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Prof. Dr. Heiner Gembris.
Infos zum Text
Musikalisch begabt sind alle Menschen, jedoch in unterschiedlichem Maße. Und jede Begabung ist es wert, erkannt und gefördert zu werden. Davon ist Prof. Dr. Heiner Gembris überzeugt. Wir trafen ihn an der Universität Paderborn, wo er seit 2001 das Institut für Begabungsforschung in der Musik (IBFM) leitet.
change: Kann man sagen, wie bestimmte Musikstücke auf uns wirken?
Prof. Dr. Heiner Gembris: Wir können aus Erfahrung sagen, wie eine bestimmte Musik auf uns persönlich wirkt oder wirken kann. Auf jemand anderen kann die Musik ganz anders wirken.
Zwar gibt es Wirkungstendenzen: Langsames Tempo, geringe Lautstärke, überwiegende Mollklänge, kleiner Tonumfang, überwiegend tiefe Töne und dunkle Klangfarben können Traurigkeit ausdrücken und eine entsprechende Stimmung in uns auslösen oder verstärken.
Eher schnelle, groovende Musik, zusammen mit höherer Lautstärke, überwiegend in Dur-Tonarten, mit großem Tonumfang und hellen Klangfarben kann gute Laune ausdrücken und auch erzeugen.
Aber es gibt keine allgemein zwingenden Gesetzmäßigkeiten. Wirkungen von Musik sind immer ein Zusammenspiel zwischen Eigenschaften der Musik, dem Hörer oder der Hörerin, ihren musikalischen Vorlieben, den situativen Bedingungen und den Funktionen, die Musik darin erfüllt. Beispielsweise gibt es verschiedene Formen der Entspannung mit Musik, wobei unterschiedliche emotionale, kognitive und körperlich-motorische Prozesse eine Rolle spielen.
Zum Beispiel …
… stellt man sich unter Entspannungsmusik oft eher langsame Musik vor, zum Beispiel langsame Sätze aus klassischen Konzerten oder Meditationsmusik. Die findet man auch auf den einschlägigen CDs.
Aber wenn wir wütend sind oder uns sehr ärgern, dann kann uns in der Regel solche Musik nicht entspannen, weil sie dem emotional-kognitiven Zustand und den damit verbundenen Bedürfnissen nicht entspricht. Ruhige Musik, die in anderen Situationen entspannend wirkt, kann in dieser Situation sogar aversiv wirken und die als unangenehm erlebte Erregung steigern, sodass wir noch ärgerlicher werden.
In den beschriebenen Situationen hilft eher laute, schnelle und vielleicht aggressiv klingende Musik. Sie ist Ausdruck der Stimmung, stimuliert zu Mitbewegungen, wodurch Spannungen abgebaut werden können.
Wann passt dann langsame, ruhige Musik?
Wenn der momentane psychophysische Aktivierungsgrad bereits relativ gering ist, kann langsame, ruhige Musik am besten dazu beitragen, einen Entspannungszustand herbeizuführen oder zu vertiefen.
Stimmt es, dass das schon im Mutterleib beginnt?
Von pränataler Musikpädagogik halte ich nicht viel. Man weiß, dass Kinder schon in den letzten Wochen im Mutterleib Musik wahrnehmen und unterscheiden können. Man weiß auch, dass Kinder sich an diese Musik nach der Geburt erinnern können. Aber nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen, dann ist sie nicht mehr vorhanden.
Wie stehen Sie zur frühkindlichen musikalischen Förderung?
Es gibt verschiedene musikalische Frühförderkonzepte. Sie können für die Kinder und Eltern einen vielseitigen positiven Bezug zum Singen, Musikhören, Musikmachen und zur Bewegung zur Musik herstellen. Es geht nicht darum, die Kinder frühzeitig zu hochleistenden Musikern zu erziehen, sondern in erster Linie darum, ihnen Spaß und Freude an Musik zu vermitteln.
Abgesehen davon, wird die musikalische Wahrnehmung gefördert, das Singen, das aktive Erkunden von Klängen und die Bewegungskoordination mit Musik. Wer die Möglichkeit hat, sollte das wahrnehmen. Gemeinsame musikalische Aktivitäten von Kindern und Eltern sind außerdem „quality time“ und können zum Wohlbefinden von Eltern und Kindern beitragen.
Kann man Fehler machen, wenn man sein Kind an Musik heranführen möchte?
Ja, wenn man mit Zwang oder Unlust an Musik herangeht. Beispielsweise einem Kind ein Instrument aufzuzwingen, das es gar nicht will. Umgekehrt wäre es auch ein Fehler, ein Kind vom Musizieren abzuhalten und seine Motivation auszubremsen.
Das heißt, die Herkunft entscheidet? Zum Beispiel wenn es darum geht, einen Zugang auch zu klassischer Musik zu bekommen?
Das Elternhaus und das soziale Milieu sind dabei in der Tat sehr wichtig. Das Spektrum an Musik, die man vor der Pubertät hört, hat einen Einfluss auf die spätere Entwicklung der Präferenzen. Kinder, die nicht die Möglichkeit hatten, in ihren Elternhäusern klassische Musik zu hören, gemeinsam Konzerte zu besuchen etc., haben eindeutige Nachteile, diese Musik überhaupt kennenzulernen. Dazu trägt bei, dass unsere musikalische Umgebung in den Medien und unserer täglichen Umwelt weitestgehend durch Popmusik dominiert ist.
Deshalb ist es notwendig, dass im Unterricht der allgemeinbildenden Schulen ein Zugang zu klassischer Musik vermittelt wird. Da die jüngeren Elterngenerationen selbst einen schwindenden Bezug zu klassischer Musik haben, ist das besonders wichtig.
Wie entwickelt sich der Musikgeschmack im Erwachsenenalter?
Der Musikgeschmack, den man am Ende der Pubertät oder bis Anfang 20 entwickelt hat, bleibt meist für die folgenden Jahrzehnte erhalten. Er gehört zur kulturellen Identität eines Menschen und bleibt relativ stabil. Das bedeutet aber nicht, dass er unveränderbar ist und sich nicht erweitern kann.
Leider gibt es dazu bislang nur wenige fundierte Erkenntnisse. Das Erwachsenenalter umfasst viele Jahrzehnte, in denen im Laufe der Zeit unterschiedliche Funktionen von Musik, Interessenlagen und Bedürfnisse auftreten, die einen Einfluss auf Musikgeschmack und Hörgewohnheiten ausüben.
So ist häufig zu beobachten, dass das Interesse an Musik während der Berufs- und Familienphase zurückgeht, dann aber etwa nach dem fünfzigsten Lebensjahr oder um die Zeit der Pensionierung wieder zunimmt.
Manche Erwachsene haben einen sehr weit gefächerten Musikgeschmack. Andere haben nur ein sehr kleines Spektrum. Wie kommt das?
Dazu gibt es eine interessante Theorie, die der amerikanische Soziologe Richard Peterson bereits in den Neunzigerjahren formuliert hat. Sie besagt, etwas verkürzt dargestellt, dass gebildete Schichten, die früher sich durch einen elitären, eklektischen Musikgeschmack, zum Beispiel für klassische Musik, ausgezeichnet haben, heute eher einen breit gefächerten Musikgeschmack aufweisen, der viele Stile und Genres umfassen kann.
Peterson hat sie als musikalische "Omnivores", musikalische Allesfresser, bezeichnet. Der Begriff Omnivores bezeichnet eigentlich Lebewesen, die alles essen oder essen können: zum Beispiel Pflanzen, Gemüse, Fleisch, Fische und auch Gummibärchen.
Musikalische Omnivores konsumieren also unterschiedlichste Arten und Stile von Musik. Durch ihren breit gefächerten Musikgeschmack unterscheiden sich die höheren Schichten der musikalischen Omnivores von den "Univores", die sozial niedrigeren Schichten angehören und sich auf ein mehr oder weniger enges Spektrum von Musik konzentrieren.
Die Breite des musikalischen Geschmacks ist demnach ein Indikator für den sozialen Status. Obwohl diese Theorie durch empirische Daten gestützt wird und einige Plausibilität hat, stellt sich die Frage, inwieweit sie auf unsere heutigen Verhältnisse in Deutschland übertragbar ist. Abgesehen von diesen soziologischen Aspekten spielen sicher auch psychologische Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale oder die musikalische Biographie eine Rolle.
Wie wirkt Musik auf die Psyche?
Ein weites Feld. Musik kann im Leben eines jeden Menschen vielfältige existenzielle Funktionen erfüllen. Zum Beispiel Gefühle ausdrücken, Emotionen vermitteln, traurig machen oder heiter stimmen, Identitätsgefühle vermitteln, entspannen, Kraft und Trost geben, Langeweile oder Einsamkeit vertreiben, Sicherheit und Orientierung geben ...
Wie ist es, wenn Menschen krank sind?
Es kommt sicher auf die Art einer Erkrankung und den Umgang damit an, ob ein Mensch dann Musik hören bzw. machen will oder kann, welche Wirkungen Musik auf Krankheiten ausübt. Damit beschäftigt sich insbesondere die Musiktherapie, die u. a. bei psychischen Erkrankungen eingesetzt wird, in der Heil- oder Sonderpädagogik, als Kommunikationsmedium bei autistischen Erkrankungen oder auch in der Gerontopsychiatrie.
Musik kann beispielsweise ein einzigartiges Kommunikationsmedium sein, das einen Zugang zu autistischen Menschen ermöglicht. Bei Patienten mit Demenz kann Musik Emotionen wecken, Erinnerungen wachrufen und zur Sprache bringen, Kommunikation anregen und so zum Wohlbefinden beitragen.
Wenn sie Lieder ihrer Kindheit hören?
Man hat schon in Studien aus den Fünfzigerjahren herausgefunden, dass bei älteren Menschen mit Demenz, aber auch bei gesunden, die Musik am beliebtesten ist, die sie in ihrer Jugendzeit, etwa bis Mitte 20, gehört haben.
Warum?
Weil Musik in dieser Zeit mit sehr intensiven Erfahrungen und Lebensereignissen verbunden ist: mit der Entwicklung der eigenen Identität, der Entwicklung eines eigenen Musikgeschmacks, mit der Begegnung mit dem anderen Geschlecht, mit der ersten Liebe etc. Musik ist in dieser Lebensphase besonders mit starken Emotionen verbunden. Ereignisse, die mit sehr starken Emotionen verbunden sind, können sich in die Psyche einbrennen und werden besser erinnert als andere.
Und dann ist die Musik wieder da. Wie ein Anker.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Musik etwas Lebensumspannendes ist: Am Anfang des Lebens, wenn wir die Sprache noch nicht beherrschen, ist sie das erste Kommunikationsmittel. Und am Ende des Lebens, wenn Krankheit die Fähigkeit zur sprachlichen Kommunikation zerstört hat, ist Musik vielleicht das letzte Kommunikationsmittel. Auch das macht Musik so einzigartig und existenziell bedeutsam.