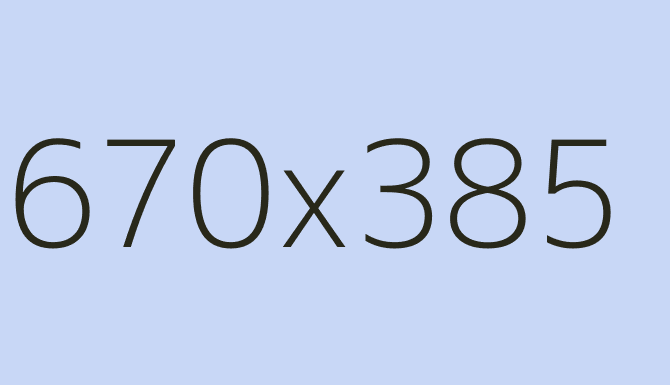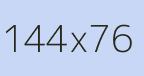Text von Tanja Breukelchen für change – das Magazin der Bertelsmann Stiftung. Ausgabe 3/2015 (gekürzte Fassung).

Bernd Lammel
Das System gesünder machen
Immer mehr Patienten erhalten unnötige Operationen und Untersuchungen. Die Liste der Probleme in unserem Gesundheitssystem ist lang. Wir trafen Menschen, die sich nicht haben unterkriegen lassen, die für Innovation stehen und den Patienten in den Mittelpunkt stellen.
Infos zum Text
Die junge Patientin wirkt ungeduldig: "Könnte ich denn bitte ein Antibiotikum bekommen?" – Dr. Angela Warnecke lächelt freundlich, fragt noch einmal genau nach den Beschwerden, schaut erneut auf den Laborbericht und den neuen Urinstix: "Ich bin absolut sicher, Sie haben keine Blasenentzündung. Die Beschwerden könnten vom Rücken kommen, es könnte auch Sinn machen, zu Ihrer Gynäkologin zu gehen, aber ein Antibiotikum verschreibe ich Ihnen nicht einfach so." Ein typischer Dialog in der kleinen Praxis in Hamburg-Eppendorf. Typisch auch für Dr. Angela Warnecke. Sie schießt nicht mit Kanonen auf Spatzen, hört aber ihren Patienten sehr genau zu: "Viele wollen sofort wieder arbeiten, die können es sich gar nicht leisten, sich einmal auszukurieren. Gerade wenn es darum geht, Familie und Beruf zu koordinieren."
Eine von so vielen Veränderungen der vergangenen Jahre, findet die Fachärztin für Allgemeinmedizin, Homöopathie und Naturheilverfahren. Und die Patienten werden immer aufgeklärter: "Ich finde das gut. Letztens kam ein Patient mit einem Stapel Unterlagen zu mir, die er sich aus dem Internet zusammengesucht hatte. Die waren alle sinnvoll. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie wir weiter behandeln."
Auch der Ruf nach ganzheitlicher Medizin wird größer. Für Warnecke, die eine homöopathische Ausbildung nach den Richtlinien des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte mit dem Diplom abgeschlossen und die Fachkunde-Prüfung vor der Ärztekammer Hamburg abgelegt hat, eine Herzensangelegenheit: "Mit den Jahren habe ich gelernt, dass man mit Naturheilverfahren viel erreicht. Trotzdem geht es nicht ohne Schulmedizin. Bei vielen Erkrankungen würde es ohne Antibiotika heikel."
Abgesehen von langen Wartezeiten bei Facharztterminen kritisiert Warnecke die vielen Operationen: "Wir machen zum Beispiel viel mehr Herzkatheter-Untersuchungen als in anderen Ländern – um uns abzusichern, aber auch, weil es Geld bringt. Das gilt auch für andere Operationen, bei denen man durchaus warten könnte."
Mehr Transparenz und ein mündiger Patient sind gefragt
Beobachtungen, die auch das Programm "Versorgung verbessern – Patienten informieren" der Bertelsmann Stiftung macht. So werden in manchen Städten und Landkreisen achtmal mehr Einwohner an den Mandeln operiert als anderswo. Ähnlich große regionale Unterschiede gibt es bei der Entfernung des Blinddarms, bei Prostata-OPs, künstlichen Kniegelenken oder Gebärmutterentfernungen. Rein medizinisch seien derart hohe Abweichungen ebenso wenig zu erklären wie durch Alters- oder Geschlechtsstrukturen, so Programmdirektor Uwe Schwenk.
Mehr Transparenz im Gesundheitswesen ist gefragt. Und vor allem: ein mündiger Patient. Gesundheitskompetenz – dazu forscht Prof. Dr. Doris Schaeffer, die an der Universität Bielefeld das Institut für Pflegewissenschaft leitet: "Gerade für ältere Menschen und solche mit Migrationshintergrund wie auch für Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau ist es schwierig, eigenständig Informationen zu suchen und einzuschätzen. Für sie ist oft der Arzt die zentrale Anlaufstelle und wird nicht angezweifelt."
Dabei sei es heute wichtiger denn je, nicht immer blind zu vertrauen: "Durch die Ökonomisierung wissen die Ärzte zuweilen nicht mehr, welchen Maßstäben sie folgen sollen. Ob sie zum Wohle und Nutzen des Patienten agieren oder zum finanziellen Wohl ihres Hauses oder ihrer Praxis. Dazu kommen unerwünschte Wirkungen von Leitlinien, also Qualitätsstandards. Da sind Ärzte manchmal in einer schwierigen Situation: Handeln sie nicht leitlinientreu, können sie rechtlich von Patienten belangt werden, auch wenn es sein kann, dass eine Leitlinie zur individuellen Situation eines Patienten weniger passt als zu der eines anderen."
"Je höher das Alter, desto schwieriger die Gesundheitskompetenz."
Prof. Dr. Doris Schaeffer, Professur für Gesundheitswissenschaften und Leiterin des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld
Neben Patienten mit mangelnder Gesundheitskompetenz stehen jene, die die Misere erkennen und besonders wachsam und informiert, zuweilen aber auch verunsichert sind. Darauf zu reagieren, sei Aufgabe der Ärzte, erklärt Schaeffer: "Es ist viel passiert im Bereich der Qualifikation, doch bleibt von den in der Ausbildung erworbenen kommunikativen Kompetenzen im Alltag nicht viel übrig, weil nicht genug Zeit besteht und die bestehenden Strukturbedingungen im Gesundheitswesen nicht so gestaltet sind, dass die Ärzte sich hinreichend Zeit für Information und Kommunikation nehmen können."
Hebammen: Gewissenhafte Betreuung und Existenzängste
Die Zeit. Ein Teufelskreis. Nicht nur für Ärzte. Auch für die Hamburger Hebamme Wibke Klug, die gleich an mehreren Fronten kämpft. In Deutschland kommt fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt. Betrachtet man die Kaiserschnittraten der einzelnen Kreise, gibt es Schwankungen zwischen 17 und 51 Prozent. Die Hamburger Klinik, in der Klug arbeitet, liegt bei einer Rate von 28 Prozent. Ihre persönliche ist mit zwölf Prozent weit darunter. "Das liegt an der 1:1-rund-um-die-Uhr-Betreuung“, erklärt sie. „Ich möchte mich während der Geburt um eine Frau kümmern können und betreue nie mehr als fünf Frauen im Monat. Das ist auf lange Sicht die sicherste Geburtshilfe. Sonst passieren Fehler."
Wibke Klug opfert viel für ihren Beruf: "Meine Tochter wird bald fünf. Es gab zum Beispiel eine Ballettaufführung, zu der ich nicht kommen konnte, da ich zwei Geburten nacheinander hatte. Wir haben niemals Wochenende. Und wenn wir zu Bett gehen, weiß meine Tochter nicht, ob ich sie morgens wecken kann." Trotzdem liebt sie ihren Beruf. Und sie würde niemals, so wie andere Kolleginnen, zehn Frauen im Monat gleichzeitig betreuen. "Ich kenne Beispiele von Hebammen, die sagen, das Kind muss um 10:30 Uhr nackt und in ein Tuch gewickelt sein, weil sie um 10:40 Uhr wieder geht. Diese Hebammen verdienen gut. Grundsätzlich würde ich auch nicht schlecht verdienen – nur bleibt am Ende einfach nichts übrig."
Das liegt daran, dass Klug für 30 Euro brutto auch mal zwei Stunden bei einer Frau sitzt. Und dann ist da noch die Sache mit den Versicherungen: "Als ich 2008 anfing, als Beleghebamme zu arbeiten, belief sich meine Haftpflichtversicherung auf 1.800 Euro im Jahr. Jetzt sind wir bei 6.500 Euro. Da natürlich auch noch die Rentenversicherung dazukommt, zahle ich monatlich rund 3.000 Euro für Versicherungen, Renten- und Krankenkasse. Und das bei 280 Euro, die ich pro Geburt verdiene. Da ist es dann eigentlich auch kein Wunder, dass so viele meiner Kolleginnen enttäuscht aufgeben müssen."
Der Teamgedanke sollte im Mittelpunkt stehen
Stichwort Pflege: Laut "Pflegereport 2030" der Bertelsmann Stiftung fehlen bis 2030 rund 500.000 Pflegekräfte. Und das, wo sich bei immer älter werdenden Patienten Krankheitsbilder verändern und Pfleger vor immer größeren Herausforderungen stehen. So wie Katy Steufmehl und Andreas Sund. Sie leiten den Pflegedienst auf der Intensivstation der Charité in Berlin. Sie finden, es muss sich nicht nur die Zahl der Pflegekräfte ändern, sondern auch deren Qualifikation: "Die Arbeit kann heute nur funktionieren, wenn man den Teamgedanken pflegt, denn jeder in seinem kleinen Bereich ist hoch spezialisiert."
An der Hochschule für Gesundheit werden Pfleger, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Hebammen und Logopäden bereits im Studium interprofessionell ausgebildet. Für Prof. Dr. Karl Reif vom Studiengang Pflege ein essenzieller Schritt: "Die Studiengänge sind so organisiert, dass die gesamte Theorie an der Hochschule stattfindet und die Praxis in den jeweiligen Einsatzorten. Als dritten Lernort haben wir SkillsLabs, wo wir mit Simulatoren, Schauspielpatienten und Videoanalysen arbeiten." Das gemeinsame Handeln der Studierenden bringe den größten Lerneffekt. Daher gibt es inzwischen auch Projekte der hsg mit der Ruhr-Universität Bochum, in denen Studierende der hsg gemeinsam mit Medizinstudierenden lernen. Das ist auch eine Reaktion auf den demographischen Wandel, erklärt Reif: „"Menschen leben länger – und zwar mit ihren Erkrankungen."
Eine Teamarbeit, die für die Klinikleiterin jeden Tag wichtig ist. Im wahrsten Sinne: überlebenswichtig. Prof. Dr. Claudia Spies ist die Leiterin der Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin der Charité und steht für Innovationen in der Intensivmedizin. Innovationen, die das Überleben begünstigen und das Leben auch nach schweren gesundheitlichen Krisen wieder lebenswert machen können. "Wer auf eine Intensivstation kommt, ist mit viel Technik, sehr viel Angst und Hilflosigkeit konfrontiert", erklärt Spies. "Die Patienten wissen, dass ihr Leben bedroht ist, aber sie haben auch Wünsche an die Intensivmedizin: zum Beispiel, dass sie keinen kognitiven Schaden erleiden." – Organversagen, schwere Herz-Kreislauf-Schädigungen, Lungenversagen, das bedeute vielfach auch eine Beteiligung des Gehirns oder der Muskeln.
"Patienten können zu Pflegefällen werden. Das ist vom Alter unabhängig."
Prof. Dr. Claudia Spies, Leiterin der Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin der Charité Berlin
Ein genauer Blick auf jeden Einzelnen, sei überlebenswichtig, erklärt Spies: "Das kann ein kognitives oder physikalisches Training sein. Oder: Bei vielen älteren Menschen ist der Hämoglobin-Wert zu niedrig, Eisensubsitution kann hierbei hilfreich sein. Vor Operationen am Oberbauch gibt es ein spezielles Atemtraining, das die Patienten stärkt, weniger Lungenentzündungen nach einer Operation zu entwickeln. All das sorgt für eine bessere Ausgangsbedingung."
Weniger Sedierung, weniger Sterblichkeit, weniger kognitive Schäden, weniger Langzeitschäden – die Intensivmedizin stehe vor einem Kulturwandel, betont Spies. Reformen und Innovationen, die angesichts der raschen Veränderungen auch in allen anderen Bereichen notwendig sind und ausschließlich einen Fokus haben müssen: das Wohl aller Patienten.